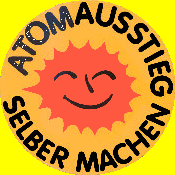|
|

Verschiedenes
Mooswald Freiburg (c) Daniel J├Ąger | | | | | Seitenwechsel | Liebe Leser,
bitte beachten Sie, dass wir weitere Meldungen dieser Seite k├╝nftig auf unserer Website prolixletter.de ver├Âffentlichen.
Klicken Sie einfach auf "mehr"
Beste Gr├╝├če
Ihr Prolix Verlag | | Mehr | | | |
| Flamingos ┬ę Zoo Basel | | | | | Neue Impfstudie in Schweizer Zoos: Schutz von Zoov├Âgeln gegen Vogelgrippe | Unter der Leitung des Zoo Basel untersuchen f├╝nf Schweizer Zoos und Tierparks, ob eine Impfung Wildv├Âgel wirksam vor der Vogelgrippe sch├╝tzt. Die zoologischen Institutionen erhoffen sich, dass dadurch Schutzmassnahmen wie die Stallpflicht in Zukunft reduziert werden k├Ânnen. Das vom Bundesamt f├╝r Lebensmittelsicherheit und Veterin├Ąrwesen (BLV) sowie den kantonalen Beh├Ârden bewilligte Forschungsprojekt startete im Oktober 2025 und pr├╝ft den Einsatz eines kommerziell erh├Ąltlichen Impfstoffs unter Zoobedingungen. Mit einem Vektorimpfstoff des Instituts f├╝r Virologie und Immunologie (IVI) wurden in einer Studie 2023/24 bereits positive Resultate erzielt.
Die Zoos in Basel und Z├╝rich, der Tierpark Bern, der Natur- und Tierpark Goldau und der Bioparc Gen├Ęve f├╝hren gemeinsam eine Impfstudie zum Schutz von Zoov├Âgeln gegen die Vogelgrippe durch. Zu den Probanden geh├Âren ├╝ber 700 Zootiere in ├╝ber 50 Arten, darunter Pinguine, Pelikane, Flamingos, Eulen sowie Tauben-, H├╝hner-, G├Ąnse-, Lauf- und Ibisv├Âgel. Ziel der Untersuchung ist es, die Wirksamkeit und Vertr├Ąglichkeit eines kommerziellen Impfstoffs an bedrohten Wildv├Âgeln zu pr├╝fen und die Immunantwort bei verschiedenen Vogelarten zu vergleichen. Zudem soll gekl├Ąrt werden, ob dank der Impfung k├╝nftig auf das Tierwohl einschr├Ąnkende Schutzmassnahmen wie die Stallpflicht verzichtet werden kann. Der Impfstoff wurde an H├╝hnern getestet und wird in Frankreich bei Mastenten eingesetzt.
Impfung nur f├╝r Forschungszwecke gestattet
In der Schweiz ist das Impfen gegen die Vogelgrippe grunds├Ątzlich verboten. Das Bundesamt f├╝r Lebensmittelsicherheit und Veterin├Ąrwesen (BLV) sowie die beteiligten Kantone bewilligen Impfungen bislang nur im Rahmen von Forschungsprojekten. Bereits 2023/24 durften der Zoo Basel, der Tierpark Bern und das Institut f├╝r Virologie und Immunologie (IVI) die Sicherheit und Wirksamkeit eines Vektorimpfstoffs zum Schutz von Zoov├Âgeln gegen hochpathogene avi├Ąre Influenzaviren (H5N1) testen. Die Studie best├Ątigte, dass eine Impfung Wildv├Âgel sicher und wirksam vor der Vogelgrippe sch├╝tzen kann. Die zugeh├Ârige Publikation erschien am 20. Oktober 2025. Die Studie best├Ątigte, dass eine Impfung Wildv├Âgel sicher und wirksam vor der Vogelgrippe sch├╝tzen kann (https://doi.org/10.1038/s41467-025-64301-5).
Zentrale Forschungsfragen
Die zweite Studie mit dem kommerziellen Impfstoff und zus├Ątzlichen Projektpartnern soll neue Erkenntnisse liefern, ob eine Impfung als erg├Ąnzende Schutzmassnahme gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe bei Zoo- und Wildtieren in Betracht gezogen werden kann. Es wird unter anderem untersucht, ob der Impfstoff bei den bereits geimpften Tieren in Basel und Bern einen Booster-Effekt ausl├Âst; und ob er bei den bisher ungeimpften V├Âgeln in Z├╝rich, Goldau und Genf eine ausreichende Immunantwort erzeugt.
Ablauf
An allen beteiligten Standorten begannen die Vogelgrippe-Schutzimpfungen im Oktober oder November 2025. Bereits geimpfte V├Âgel erhielten eine Impfdosis, bisher ungeimpfte Tiere zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen. Blutuntersuchungen zur Beurteilung der Immunantwort und der Dauer des Impfschutzes folgen nach einem definierten Schema. Bei zufriedenstellenden Resultaten soll der Impfstoff auch in der n├Ąchsten Saison (2026/27) weiter eingesetzt und an Zoov├Âgeln erforscht werden.
Das Besondere der Untersuchung ist, dass sie unter Zoo- und nicht unter Laborbedingungen durchgef├╝hrt wird. Sie erfolgt im Rahmen einer Doktorarbeit, die auf mindestens zwei Jahre angelegt ist. Das IVI begleitet die Studie wissenschaftlich und f├╝hrt die labortechnischen Auswertungen durch. Erste Resultate werden im Sommer 2026 erwartet. | | Mehr | | | |
| | | | | | Freiburg: Umzug ins k├╝nstliche Meer | Die Banggai-Kardinalbarsch-Jungfische auf dem Mundenhof sind ins gro├če Salzwasserbecken umgezogen
Die kleinen Banggai-Kardinalbarsch-Jungfische im Aquarium des Mundenhofs z├Ąhlten im Sommer zu den gro├čen Publikumslieblingen. Im M├Ąrz hatten die Z├╝chter*innen des Aquarienvereins bei dieser gef├Ąhrdeten Art erfolgreich f├╝r Nachwuchs gesorgt. Nun wird er in ein gro├čes, artgerechtes Aquarium ├╝berf├╝hrt.
Es ist das erste Mal, dass der Tierpark Salzwasserfische aus der eigenen Zucht im Schaubecken pr├Ąsentieren kann. 2500 Liter fasst dieser Glaskasten, er geh├Ârt damit zu den gr├Â├čten Aquarien auf dem Mundenhof. Die fast acht Monate alten Barsche ÔÇô von Fachleuten und Hobbyaquarianer*innen auch Kauderni genannt ÔÇô k├Ânnen darin als Schwarm durch die Gegend schwimmen, so wie in freier Wildbahn.
Nachhaltiges Handeln ist dem Mundenhof ein wichtiges Anliegen, so auch bei den Fischen. Der lokale Aquarienverein k├╝mmert sich ehrenamtlich in einem umgebauten Pferdestall um die Tiere. Die Hobbyz├╝chter*innen passen zum einen darauf auf, dass nicht zu viele Fische im Becken sind. Au├čerdem achten sie auf die seri├Âse Herkunft der neuen Fische, etwa aus einer Zucht oder von Privatpersonen.
Die meisten S├╝├čwasserfische auf dem Mundenhof stammen aus der eigenen Z├╝chtung und nicht aus Wildf├Ąngen. Der Banggai-Kardinalbarsch, bei dem vor etwa acht Monaten die erste Nachzucht gelungen ist, ist stark gef├Ąhrdet. Er steht auch auf der Roten Liste bedrohter Tierarten. Kauderni sind aber vergleichsweise gut zu z├╝chten. Man muss es aber halt tun ÔÇô und das hat der Aquarienverein Freiburg jetzt, auch um Artgenossen in Freiheit den Fang zu ersparen. Jede Nachzucht vor Ort ist eine Entlastung f├╝r die Kauderni in ihrer Heimat: die indonesischen Banggai-Inseln.
Nun lassen sich die etwa 15 schwarz-wei├č gestreiften Jungtiere auf dem Mundenhof bestaunen. Zusammen mit Kaiser- und Doktorfischen schwimmen sie im Aquarium, wenn auch noch etwas vorsichtig. Zwar sind die anderen Fische keine Fressfeinde, die Kauderni sind allerdings erst drei Zentimeter lang. Sie gew├Âhnen sich aber schnell an die neue Situation. Wie in der Natur finden sie jetzt Schutz zwischen den langen Stacheln der Diademseeigel und in der N├Ąhe von Anemonen. Und auch die Z├╝chter*innen selbst blicken mit viel Freude auf das wuselige Treiben im Wasser.
F├╝r alle Interessierten der Wasserwelt bietet der Aquarienverein am Sonntag, 25. Januar, auf dem Mundenhof wieder eine F├╝hrung im Schauaquarium an. | | | | | |
| Gorilla Yeba ┬ę Zoo Basel | | | | | Neuer Silberr├╝cken im Zoo Basel | Am 17. Oktober 2025 ist ein neuer Gorilla-Silberr├╝cken (Gorilla gorilla gorilla) im Affenhaus des Zoo Basel eingezogen. Yeba (13), wie das Gorilla-M├Ąnnchen heisst, kommt aus dem Zoo Thoiry in Frankreich. Er tritt die Nachfolge von Silberr├╝cken MÔÇÖTong├ę an, den der Zoo Basel im Juni dieses Jahres verabschieden musste. Die behutsame Zusammenf├╝hrung mit der bestehenden Gorillagruppe, ein anspruchsvoller Prozess, ist bis jetzt gelungen.
In diesem Jahr musste sich der Zoo Basel von seinem bisherigen Gorilla-Silberr├╝cken (Gorilla gorilla gorilla) MÔÇÖTong├ę verabschieden. Der Zolli berichtete am 27. Juni 2025. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger wurde vom EAZA Ex-situ-Programm (EEP, Erhaltungszuchtprogramm der European Association of Zoos and Aquaria) koordiniert. Vor knapp drei Wochen ist nun ein neuer Silberr├╝cken im Affenhaus angekommen.
Einzug ins Affenhaus
Am 17. Oktober 2025 ist der 13-j├Ąhrige Gorilla-Silberr├╝cken Yeba im Affenhaus des Zoo Basel eingezogen. Yeba wurde im Zoo Givskud in D├Ąnemark geboren und lebte zuletzt im franz├Âsischen Zoo Thoiry. Er ist ein neugieriger, selbstsicherer, umg├Ąnglicher und sanfter Gorilla. Mit seiner Ankunft ├╝bernimmt Yeba eine zentrale Rolle in der Gorillagruppe und definiert deren soziale Ordnung.
Schrittweise Integration in die Gruppe
Die Eingliederung eines Silberr├╝ckens in eine bestehende Gruppe ist ein komplexer Vorgang. Sie erfolgt behutsam unter sorgf├Ąltiger Beobachtung der Tierpflegenden und des Kurators. Nach diesem Prinzip erfolgte auch Yebas Integration: Schon wenige Stunden nach seiner Ankunft konnte er ersten Sicht- und Ber├╝hrungskontakt zur Gruppe aufnehmen. Am Nachmittag des Eintreffens wurde er dann erstmals mit dem zehnj├Ąhrigen Gorilla-Weibchen Makala zusammengef├╝hrt. In den darauffolgenden Tagen lernte er nach und nach die ├╝brigen Gruppenmitglieder einzeln kennen. So konnte Yeba seine F├╝hrungsrolle schrittweise ├╝bernehmen und etablierte seine Dominanz gegen├╝ber seinen neuen Gruppenmitgliedern. Seit dem 25. Oktober 2025 ist die Gruppe nun vereint und akzeptiert ihn als dominantes M├Ąnnchen. Bis er sich definitiv als Gruppenoberhaupt etabliert hat, wird es aber noch einige Zeit dauern.
Zusammenleben
F├╝r Yeba ist es das erste Mal, dass er eine Gorillagruppe anf├╝hrt. Im Zoo Thoiry lebte er in einer sogenannten Bachelor-Gruppe, einer Gruppe ausschliesslich m├Ąnnlicher Gorillas. Nun muss er sich an seine neue Rolle gew├Âhnen und trifft dabei auf seine neuen Mitbewohner, zu denen die Weibchen Joas (36), Adira (19), Makala, (10), Qaziba (6) und das Gorilla-M├Ąnnchen Mobali (10) geh├Âren. | | Mehr | | | |
| | | | | | 15 Jahre Spitzenleistung beim Einsatz von Recyclingpapier | Papieratlas 2025: Immer mehr St├Ądte setzen auf Recyclingpapier mit Blauem Engel Berlin, 4. November 2025: Parlamentarische Staatssekret├Ąrin Rita Schwarzel├╝hr-Sutter hat heute im Bundesumweltministerium in Berlin die Stadt Freiburg als ÔÇ×MehrfachsiegerÔÇť ausgezeichnet. Seit 15 Jahren bringt Freiburg Bestleistungen im Papieratlas-St├Ądtewettbewerb der Initiative Pro Recyclingpapier (IPR). In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 110 Gro├č- und Mittelst├Ądte mit einer durchschnittlichen Recyclingpapierquote von 90 Prozent.
Freiburg nutzt in der Verwaltung, den Schulen und der Hausdruckerei konsequent zu 100 Prozent Blauer-Engel-Papier und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Im Vergleich zu Frischfaserpapier bewirkte die Stadt in den vergangenen 15 Jahren eine Einsparung von ├╝ber 99 Millionen Litern Wasser und mehr als 22 Millionen Kilowattstunden Energie. Die Wassereinsparung entspricht dem t├Ąglichen Bedarf von mehr als 823.000 Menschen. Die eingesparte Energie k├Ânnte den j├Ąhrlichen Strombedarf von rund 6.420 Drei-Personen-Haushalten decken.
Der Papieratlas dokumentiert seit 2008 j├Ąhrlich den Papierverbrauch und die Recyclingpapierquoten in deutschen St├Ądten, seit 2016 auch in Hochschulen und seit 2018 in Landkreisen. Kooperationspartner sind das Bundesumweltministerium, das Umweltbundesamt, der Deutsche St├Ądtetag, der Deutsche St├Ądte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag sowie der Deutsche Hochschulverband. Die Wettbewerbe stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider. | | | | | |
| | | | | | Aus Sicherheitsgr├╝nden: Stadt Freiburg muss B├Ąume f├Ąllen | Auch in diesem Herbst muss das Garten- und Tiefbauamt (GuT) B├Ąume in der Stadt f├Ąllen. Um eine Gef├Ąhrdung der B├╝rger*innen auszuschlie├čen, m├╝ssen die gr├Â├čtenteils kranken B├Ąume entfernt werden. Bei der allj├Ąhrlichen Baumkontrolle hat das GuT 240 B├Ąume identifiziert, die nicht mehr stehen bleiben k├Ânnen. Dabei handelt es sich vor allem um Park- und Stra├čenb├Ąume. Die Arbeiten starten in dieser Woche.
Die meisten B├Ąume sind bereits abgestorben oder stark gesch├Ądigt. In weiteren F├Ąllen sorgt Pilzbefall f├╝r F├Ąulen im Stamm oder Wurzelbereich. Das gef├Ąhrdet die Stand- und Bruchsicherheit. F├╝r jeden gef├Ąllten Einzelbaum wird ein neuer gepflanzt. Das GuT stellt betroffenen Einrichtungen sowie den B├╝rger- und Lokalvereinen eine detaillierte Liste der B├Ąume zur Verf├╝gung, die gef├Ąllt werden.
In geschlossenen Geh├Âlzbest├Ąnden, etwa entlang von Stra├čen oder Gew├Ąssern, wird nur dann ein neuer Baum gepflanzt, wenn die nat├╝rliche Verj├╝ngung des Bestands nicht ausreicht.
Teil der Baumarbeiten ist au├čerdem der R├╝ckschnitt der Geh├Âlze entlang von Stra├čen, Wasserl├Ąufen und B├Âschungen. | | Mehr | | | |
| | | | | | Mehr Gr├╝n f├╝r die Wiehre | Asphaltfl├Ąche wird zur kleinen Gr├╝noase in der Urachstra├če
Initiative ÔÇ×Omas und Opas for FutureÔÇť gibt den Ansto├č
Mehr Klimaresilienz und Aufenthaltsqualit├Ąt
Mehr Gr├╝n, weniger Grau: An der Ecke Urachstra├če/Hildastra├če wurde jetzt eine ungenutzte Asphaltfl├Ąche entsiegelt und in eine kleine Gr├╝noase mit Sitzbank verwandelt. Entstanden ist ein Ort, der das Stadtklima verbessert und zum Verweilen einl├Ądt. Den Ansto├č gab die Initiative ÔÇ×Omas und Opas for FutureÔÇť, die sich f├╝r Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Freiburg engagiert. Sie ├╝bernimmt k├╝nftig auch die Patenschaft f├╝r die Fl├Ąche im Rahmen von ÔÇ×Freiburg packt anÔÇť.
Die rund 65 Quadratmeter gro├če Fl├Ąche wurde im Zuge der st├Ądtischen Kampagne ÔÇ×Freiburger Gr├╝noasenÔÇť umgestaltet. Die Freiburger B├╝rgerstiftung spendete zus├Ątzlich eine Sitzbank, sodass der neue kleine Treffpunkt gleich genutzt werden kann.
Oberb├╝rgermeister Martin Horn: ÔÇ×Unsere Gr├╝noasen schaffen an verschiedenen Stellen in der Stadt neue Aufenthaltsorte, die zugleich das Stadtklima verbessern. Gerade in Zeiten zunehmender Hitzetage sind solche kleinen gr├╝nen und k├╝hlenden Inseln wichtig und erh├Âhen die Aufenthaltsqualit├Ąt in der Stadt. Wir wollen Freiburg an vielen gro├čen und kleinen Treffpunkten aufwerten. Dabei setzen wir auf den Austausch mit den Menschen in den Quartieren. Das Beispiel der Urachstra├če zeigt, wie viel mehr vorangeht, wenn Verwaltung und B├╝rgerschaft zusammenarbeiten. Vielen Dank f├╝r das Engagement f├╝r unser Freiburg.ÔÇť
Baub├╝rgermeister Martin Haag: ÔÇ×Entsiegelungen wie hier in der Wiehre leisten einen sp├╝rbaren Beitrag zur Klimaanpassung: Sie k├╝hlen das Mikroklima, f├Ârdern die Versickerung von Regenwasser und schaffen Lebensraum f├╝r Pflanzen und Insekten. Auch wenn solche Ma├čnahmen aufwendig sind, zeigen sie, wie wichtig eine kluge Fl├Ąchenplanung f├╝r eine lebenswerte Stadt ist.ÔÇť
Solche Projekte sind aufgrund des Aufwands meist nur im Zusammenhang mit gr├Â├čeren Stra├čenumbauten oder Sanierungen umsetzbar. In diesem Fall fiel die Entscheidung dennoch zugunsten der Entsiegelung ÔÇô wegen der zentralen Lage nahe des Alten Wiehrebahnhofs, der relativ gro├čen Fl├Ąche sowie des Engagements aus der Zivilgesellschaft f├╝r die Pflege vor Ort.
Das Projekt ist ein Beispiel daf├╝r, wie Verwaltung, B├╝rgerschaft und lokale Initiativen gemeinsam an der klimafreundlichen Gestaltung des ├Âffentlichen Raums arbeiten. | | | | | |
| | | | | | Wieder auf dem Vormarsch ÔÇô Gefl├╝gelpest breitet sich aus | Gefl├╝gelbetriebe m├╝ssen Biosicherheitsma├čnahmen einhalten
In den vergangenen zwei Wochen kam es in Deutschland zu mehreren Vogelgrippe-Ausbr├╝chen bei Wildv├Âgeln und in Gefl├╝gelbetrieben. Auch in Baden-W├╝rttemberg ist das Virus angekommen: In einem Betrieb im Alb-Donau-Kreis wurde das hochpathogene Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, hat die konsequente Einhaltung von Biosicherheitsma├čnahmen jetzt h├Âchste Priorit├Ąt ÔÇô darauf weist die Veterin├Ąrbeh├Ârde Freiburg hin.
Was ist die Gefl├╝gelpest?
Bei der Gefl├╝gelpest handelt es sich um eine Infektion des Gefl├╝gels mit hochpathogenen, also stark krank machenden, vogelspezifischen Influenzaviren. Insbesondere Wildv├Âgel k├Ânnen das Virus ├╝ber weite Strecken verschleppen und unter anderem ├╝ber den Kot infizierter V├Âgel in Hausgefl├╝gelbest├Ąnde eintragen. Betroffene Tiere erkranken meist schwer und sterben innerhalb k├╝rzester Zeit.
Welche Regeln gelten f├╝r Gefl├╝gelhalter*innen?
Wer Gefl├╝gel h├Ąlt, muss daf├╝r sorgen, dass die Tiere nur dort gef├╝ttert werden, wo Wildv├Âgel keinen Zugang haben. Zudem m├╝ssen Futter, Einstreu und sonstige Gegenst├Ąnde, mit denen Gefl├╝gel in Ber├╝hrung kommen kann, f├╝r Wildv├Âgel unzug├Ąnglich aufbewahrt werden. Das Betreten der Haltungseinrichtungen darf nur mit stallspezifischer Kleidung bzw. Schutzkleidung erfolgen, das gilt auch f├╝r das Schuhwerk. Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Haltungseinrichtung sollten die Mitarbeitenden ihre H├Ąnde mit Wasser und Seife gr├╝ndlich waschen. Da die Gefl├╝gelpest in Europa zwischenzeitlich ganzj├Ąhrig und nicht nur saisonal auftritt, ist es besonders wichtig, die Biosicherheitsma├čnahmen fortlaufend konsequent einzuhalten. Diese sind in der Gefl├╝gelpestVerordnung festgeschrieben.
Welche Betriebe m├╝ssen die Biosicherheitsma├čnahmen einhalten?
In Baden-W├╝rttemberg m├╝ssen seit Januar 2023 auch Gefl├╝gelhaltungen mit weniger als 1000 Tieren strenge Biosicherheitsma├čnahmen einhalten. Die entsprechende Allgemeinverf├╝gung sowie Infos zur aktuellen Situation in Baden-W├╝rttemberg finden sich unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/tierschutztiergesundheit/tiergesundheit/tierkrankheiten-tierseuchenzoonosen/vogelgrippe/aktuelles.
Was muss ich bei einem Verdacht unternehmen?
Kommt es in Gefl├╝gelbest├Ąnden vermehrt zu pl├Âtzlichen Todesf├Ąllen oder Krankheitsanzeichen mehrerer Tiere ist unbedingt ein praktizierender Tierarzt hinzuzuziehen. Bei einem konkreten Verdacht auf die Gefl├╝gelpest im Stadtkreis Freiburg ist die Veterin├Ąrbeh├Ârde des Amts f├╝r ├Âffentliche Ordnung, telefonisch unter 0761 201-4965; oder per Mail an veterinaerbehoerde@freiburg.de zu informieren.
K├Ânnen sich auch Menschen infizieren?
Vereinzelt wurden Gefl├╝gelpestviren bei Mitarbeitenden infizierter Gefl├╝gelbetriebe nachgewiesen. Daher ist beim Umgang mit toten V├Âgeln stets auf entsprechende Hygiene zu achten. Verendete Tiere sollten nur mit Handschuhen ber├╝hrt, die H├Ąnde danach gewaschen und desinfiziert werden.
Wie viele Gefl├╝gelbetriebe gibt es in Freiburg?
Im Stadtkreis Freiburg gibt es 329 registrierte Gefl├╝gelhalter*innen. Bisher ist im Stadtkreis Freiburg noch kein Betrieb von der Gefl├╝gelpest betroffen.
Weitere Informationen zur Gefl├╝gelpest gibt es auf der Website des Bundesministeriums f├╝r Ern├Ąhrung und Landwirtschaft unter https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tiergesundheit/tierseuchen/gefluegelpest.html. | | Mehr | | | |
|
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276
277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345
346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
438 439 440
|
|
|